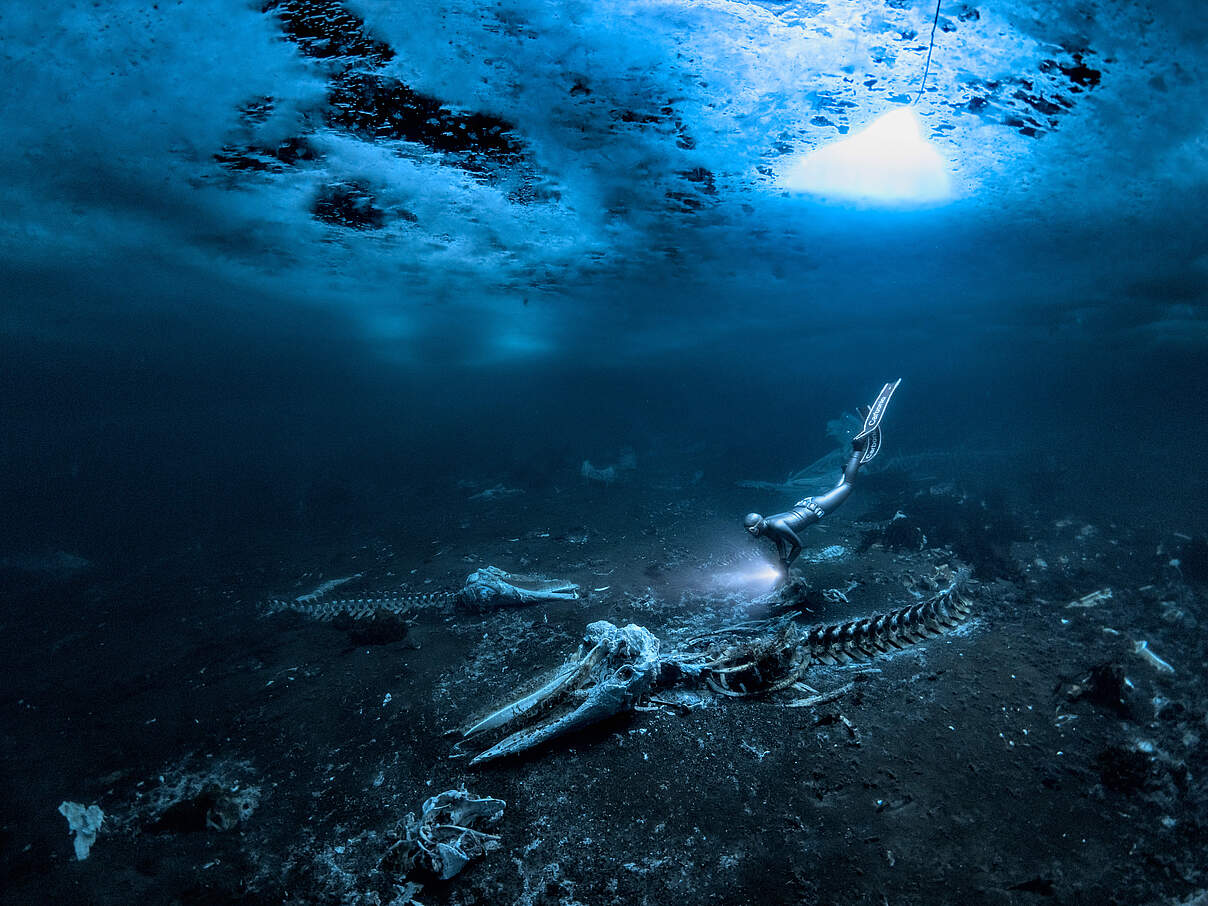Es geht um unsere Lebensgrundlage, unsere Erde. Es geht um Tiger in Sumatra, Menschenaffen im Kongobecken, Eisbären in der Arktis – und unseren ökologischen Fußabdruck.
Es geht um Artenschutz im Amazonas genauso wie um Wölfe und Wattenmeer. Ob Plastik oder Landwirtschaft, Klima oder Regenwald: Die WWF-Projekte machen Umweltschutz lokal – und wirken global – für uns alle!