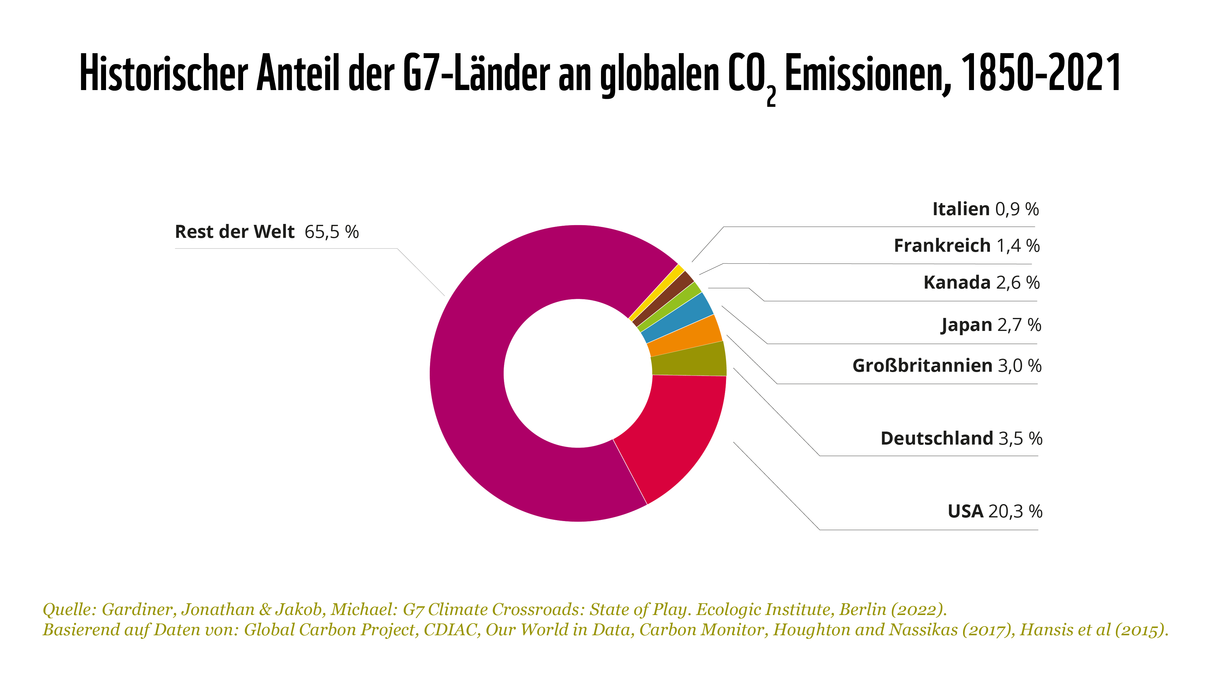Der G7-Gipfel, der vom 19. bis 21. Mai 2023 im japanischen Hiroshima abgehalten wurde, fand im Schatten geopolitischer Krisen statt, die traditionelle Allianzen und Ansätze zur Bewältigung globaler Herausforderungen, wie der Klima- und Naturkrise, in Frage stellen.
Die Erwartungen an den G7-Gipfel waren hoch, da er als Meilenstein für politische Signale auf dem Weg zur 28. UN-Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gesehen wurde. Doch neue und ehrgeizige Signale, die zeigen, dass diese großen Industriestaaten bereit sind zu tun, was notwendig ist, um die globale Erhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, blieben aus.
Die Haltung der G7-Staaten zum Thema Energie schien hauptsächlich von kurzfristigen Bedenken zur nationalen Energiesicherheit getrieben zu sein und nicht von der globalen Notwendigkeit, den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe als wichtigste Maßnahme zur Bewältigung der Klimakrise zu unterstützen. Das zeigt sich am Beharren Deutschlands auf einer verstärkten Nutzung von fossilem Flüssiggas und an der Weigerung Japans, die Nutzung von Kohle zu beenden. Dennoch konnten sich die G7-Staaten zum ersten Mal auf ein gemeinsames Ziel zum Ausbau erneuerbarer Energien einigen und verpflichteten sich in ihrer Abschlusserklärung dazu, die Offshore-Windkapazitäten bis 2030 um 150 Gigawatt und die Solarkapazitäten um mehr als ein Terawatt zu erhöhen. Dieses Bekenntnis zu einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung muss nun schnell umgesetzt werden.
Schließlich hat die G7 die Gelegenheit verpasst, konkrete Zusagen zur Klimafinanzierung, insbesondere der Finanzierung von klimabedingten Schäden und Verlusten, und zum Schuldenerlass für Länder des Globalen Südens zu machen. Dies müssen sie bei weiteren multilateralen Treffen in diesem Jahr nachholen und ihre Anstrengungen etwa beim G20-Gipfel im September in Indien und bei der COP 28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten verstärken.