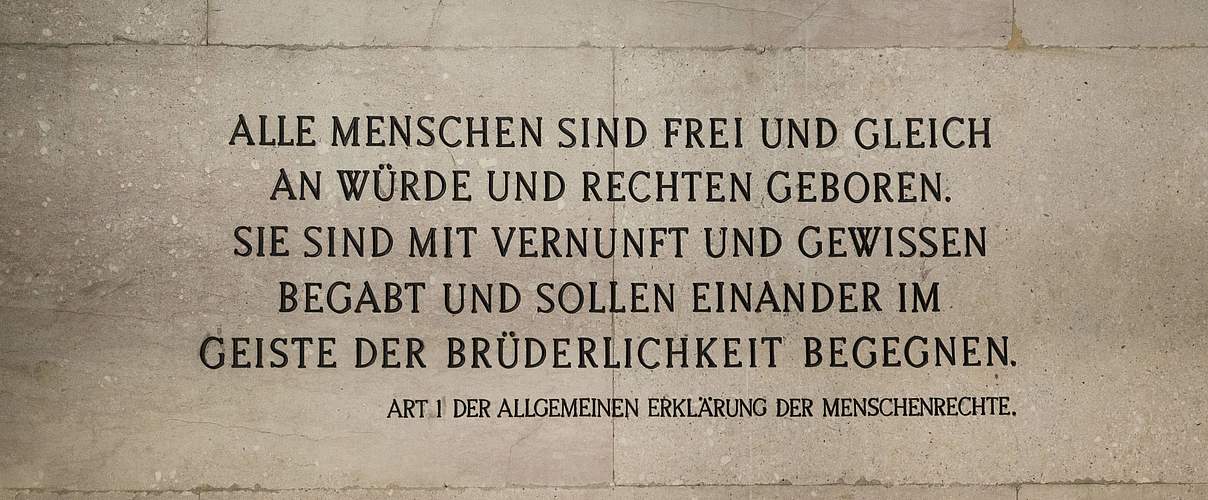Im brasilianischen Amazonas zum Beispiel sind die Bewohner großem Druck ausgesetzt. Der WWF unterstützt dort die indigene und traditionelle Bevölkerung im Kampf um ihr Überleben und ihr Land. „Es ist das größte Projekt des WWF Deutschland in Südamerika“, sagt Ochs. „Wir schützen dort eine Fläche von etwa 10,7 Millionen Hektar zusammen mit den Bewohnern.“ Fast 50.000 Menschen leben auf 30 indigenen Territorien und zwei Territorien traditioneller Völker. Die Gebiete befinden sich an der größten Entwaldungsfront der Erde. Sie sind die letzten grünen Inseln, die sich neben den bereits bestehenden Schutzgebieten der Abholzung entgegenstemmen.
Illegaler Holzeinschlag, Jagd, Bergbau und Landraub nehmen in Brasilien zu, damit einher gehen Waldbrände. Gegen illegale Aktivitäten wird hingegen zu wenig getan. Die Gewalt eskaliert, Drohungen gegen indigene Völker und andere Menschenrechtsaktivisten im Umweltbereich haben zugenommen. „Einer unserer Hauptaugenmerke liegt auf dem Bundesstaat Rondônia, wo wir mit der Kanindé Ethno-Environmental Defense Association und mehreren lokalen indigenen Vereinigungen zusammenarbeiten“, erläutert Ochs. „In den fünf am stärksten bedrohten indigenen Gebieten unterstützen wir dort die Gemeinden bei der Nutzung von Technologien wie Drohnen, Handy-Apps und Fernerkundungsdaten, damit sie illegale Aktivitäten verfolgen und melden können.“