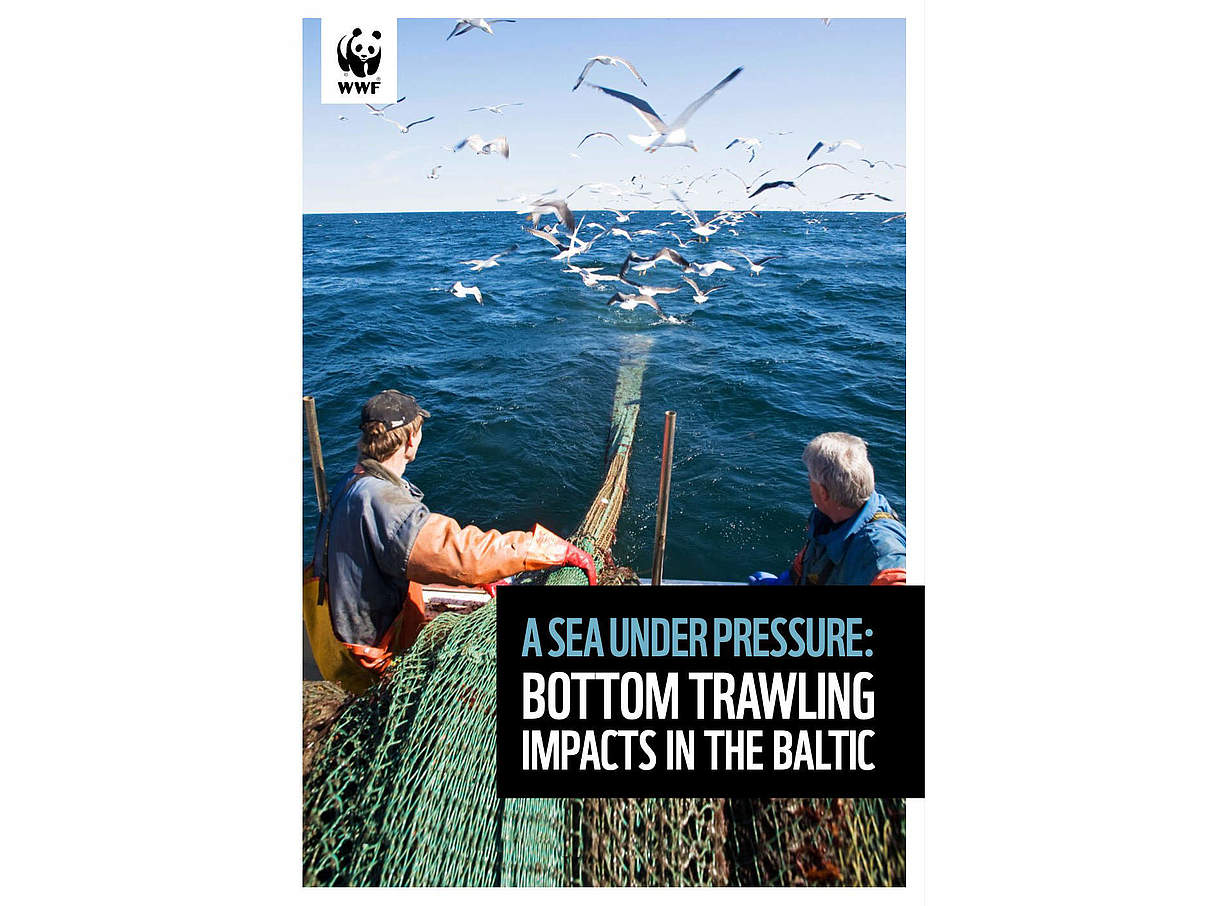Der Dorsch ist eine der wichtigsten Arten der Ostsee, sowohl für das Ökosystem als auch für die Fischerei. Die Dorschbestände der Ostsee wurden seit Jahrzehnten überfischt, denn es wurde alljährlich weit mehr entnommen, als nachwachsen konnte. Durch diese andauernde Überfischung sind sowohl der Bestand in der westlichen als auch der in der östlichen Ostsee zusammengebrochen.
Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt seit mehreren Jahren dass überhaupt kein Dorsch mehr gefangen wird, und die Europäische Union erlaubt nur noch unvermeidbare Beifänge. Besonders durch das Entnehmen der älteren Tiere, die meist einen höheren Fortpflanzungserfolg haben, wird eine Erholung zusätzlich erschwert.
Das bedroht nicht nur das Ökosystem – auch die Fischerei leidet, Wurden 1996 beispielsweise noch 38.505 Tonnen Dorsch in der westlichen Ostsee an Land gebracht, waren es 2015 nur noch 8.390 Tonnen – heute sind es nur noch wenige Hundert Tonnen Beifang.